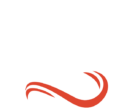Knisterndes Feuer, angenehme Wärme, das leise Knacken im Ofen – so soll der Abend am Kamin eigentlich sein. Doch wenn das Brennholz plötzlich mehr Rauch als Glut produziert, wenn es nicht richtig trocknen will oder sogar schimmelt, dann liegt das oft nicht am Holz selbst, sondern an seiner Aufbewahrung. Denn falsch gelagertes Kaminholz verliert nicht nur an Heizwert, sondern kann auch gefährlich werden. Wer weiß, worauf es bei der Lagerung wirklich ankommt, spart nicht nur Geld und Aufwand, sondern schützt auch seinen Ofen – und die Nerven.
Frisch gesägt ist nicht gleich einsatzbereit
Viele glauben, dass Kaminholz nach dem Spalten direkt gelagert werden kann – und wenige Monate später im Ofen landet. Doch dieser Gedanke ist trügerisch. Frisch geschlagenes Holz enthält bis zu 60 % Wasser. Damit es effizient und sauber verbrennt, sollte die Restfeuchte unter 20 % liegen. Und das dauert – je nach Holzart – mindestens 12 bis 24 Monate. Entscheidend ist dabei nicht nur der Zeitraum, sondern auch die richtige Umgebung: luftig, trocken, sonnig, aber nicht völlig ungeschützt.

Der richtige Ort entscheidet über alles
Egal, ob du dein Kaminholz direkt am Haus, an der Grundstücksgrenze oder frei im Garten lagern möchtest – der Standort hat Einfluss auf die Trocknung und Haltbarkeit. Ideal ist ein Platz, an dem Wind gut durchziehen kann, aber gleichzeitig kein Dauerregen direkt aufs Holz trifft. Süd- oder Westseiten eines Hauses bieten sich an, da hier Sonne und Wind zusammenwirken. Wichtig ist außerdem, dass das Holz nicht direkt auf dem Boden liegt – Paletten, Metallgestelle oder Lattenroste sorgen für Luftzirkulation und schützen vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Ein hochwertiges Holzlager findest du unter https://meisterbox.de/Holzlager/, ideal für alle, die auf langlebige und durchdachte Konstruktionen setzen.
Belüftung schlägt Einhausung
Viele neigen dazu, ihr Holz möglichst „gut“ zu schützen – etwa mit Planen oder in geschlossenen Schuppen. Dabei passiert genau das Gegenteil: Das Holz kann nicht mehr atmen. Die Folge sind Staunässe, Schimmel und Fäulnis. Besser ist eine offene, aber überdachte Konstruktion, bei der Luft ungehindert durchströmen kann. Genau hier setzen moderne Holzlager an, die Form und Funktion verbinden: schlank gebaut, witterungsfest, oft sogar modular erweiterbar. Wer selbst baut, sollte auf großzügige Abstände zwischen den Stapelreihen und eine solide Dachneigung achten.
Mehr ist nicht immer besser
Auch beim Holzstapeln lohnt es sich, pragmatisch zu denken. Zu große Mengen auf engem Raum führen dazu, dass die innere Schicht nicht ausreichend Luft bekommt. Das mindert die Trocknung – oder macht sie sogar unmöglich. Stapel sollten daher nicht höher als zwei Meter sein. Zwischen Wand und Holz empfiehlt sich ein Abstand von mindestens fünf Zentimetern. Noch besser ist eine freistehende Lagerform. So entsteht eine gleichmäßige Belüftung von allen Seiten.

FAQ: Häufige Fragen zur richtigen Lagerung von Kaminholz
Wie lange muss frisches Holz trocknen, bevor es verheizt werden darf?
Frisch geschlagenes Holz sollte mindestens 12 bis 24 Monate trocknen – je nach Holzart und Witterungsbedingungen. Harthölzer wie Buche oder Eiche brauchen tendenziell länger als Nadelholz.
Muss Kaminholz draußen unbedingt überdacht gelagert werden?
Ja, unbedingt. Auch wenn Holz wetterfest aussieht, darf es nicht dauerhaft Regen und Schnee ausgesetzt sein. Ein einfaches Dach reicht oft aus – wichtig ist die Kombination mit ausreichender Belüftung.
Warum ist Luftzirkulation so wichtig?
Weil stehende Luft Feuchtigkeit nicht abführt. Ohne Luftzirkulation entsteht Schimmel oder Fäulnis. Deshalb sollten Seiten und Rückwand des Lagers nie komplett dicht sein.
Welchen Abstand sollte Kaminholz zum Boden haben?
Mindestens 10 bis 15 cm Abstand sind ideal. Paletten, Gitterroste oder Steine sorgen dafür, dass keine Bodenfeuchte ins Holz zieht.
Wie hoch darf ein Holzstapel sein?
Maximal zwei Meter, damit die Luft auch im Inneren des Stapels zirkulieren kann und das Umsturzrisiko gering bleibt. Für zusätzliche Sicherheit können Querstreben oder Seitenstützen sorgen.
Wo ist der beste Ort für ein Holzlager?
Optimal sind windige, sonnige Plätze, z. B. an der West- oder Südseite des Hauses. Dabei sollte das Lager nicht direkt an einer Hauswand stehen, sondern etwas Abstand haben – das schützt Wand und Holz zugleich.
Kann ich mein Kaminholz mit einer Plane abdecken?
Nur mit Einschränkungen. Planen führen schnell zu Hitzestau und Schimmel, wenn sie das Holz komplett einschließen. Besser ist eine Plane, die nur von oben schützt und an den Seiten offen bleibt.
Lohnt sich ein gekauftes Holzlager?
Ja – wenn du wenig Zeit oder Platz hast. Moderne Holzlager sind oft modular erweiterbar, witterungsfest und gut durchlüftet. Außerdem sehen sie oft besser aus als improvisierte Lösungen und passen in fast jeden Gartenstil.
Kann Holz auch im Winter weiter trocknen?
Nur begrenzt. Die größte Trocknung passiert im Frühling und Sommer. Im Winter ruht der Prozess, deshalb ist es wichtig, das Holz vor dem Herbst gut vorzubereiten und zu stapeln.
Muss gespaltenes Holz anders gelagert werden als ganze Scheite?
Sowohl ja als auch nein. Gespaltenes Holz trocknet deutlich schneller, deshalb solltest du es auch früher stapeln. Ganze Scheite brauchen deutlich länger – oft ein Jahr zusätzlich.
Das gute Gefühl beim Griff zum Scheit
Ein trockenes, gut belüftetes und geschütztes Brennholz-Lager sorgt nicht nur für einen sauberen Abbrand im Ofen, sondern auch für ein gutes Gefühl: Kein Schimmel, kein Moder, kein Ärger mit der Feuchtigkeit. Wer einmal erlebt hat, wie unkompliziert das Heizen mit gut vorbereitetem Holz sein kann, der will nie wieder zurück. Und mit der richtigen Struktur – ob gekauft oder selbst gebaut – wird die Lagerung zum Selbstläufer. Wer den Platz gut nutzt, auf Durchlüftung achtet und keine Kompromisse bei der Qualität eingeht, hat das ganze Jahr über verlässliches Feuerholz griffbereit. Und genau das macht den Unterschied – nicht nur an kalten Tagen.
Bildnachweis: Adobe Stock/ Serhii, Tanja Esser, Marco2811